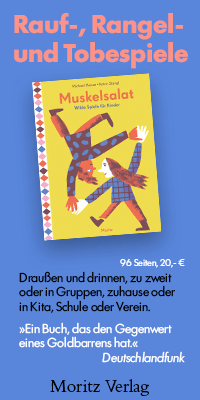|
Eine Geschichte von städtischem Strukturwandel und der Wirkung öffentlicher Empörung
Öffentliche Debatten zehren von Symbolen. »Rütli« ist so eins. Das Kollegium der gleichnamigen Hauptschule in Berlin Neukölln hatte im Jahr 2006 in einem Offenen Brief unmissverständlich bekannt, es sehe sich den unhaltbaren Zuständen nicht länger gewachsen. Der Hilferuf, der die Frustration und den Protest vieler Lehrerinnen und Lehrer artikulierte, zeigte Wirkung. Die hoffnungslose »Restschule« wurde zum Sinnbild für bildungspolitischen Aufbruch. Der in Entstehung begriffene »Campus Rütli« wurde zu einem Leuchtturmprojekt mit bundesweiter Ausstrahlungskraft und wird nahezu einhellig als wegweisend gelobt. Soweit die öffentliche Wahrnehmung. Aber stimmt das Bild vom Bildungsmärchen Rütli? Und wie erklärt sich der zauberhafte Wandel? – Max Lill stellt sich diesen Fragen.
Fällt das Stichwort »Rütli«, steigen die Bilder von vor zwei Jahren auf: Tumultartige Szenen vor dem hohen Gitterzaun der Schule, an dem sensationshungrige Journalisten, aufgeregte Schüler und nervöse Lehrer aufeinandertreffen.
Tags darauf steht »Gewaltkids« in blutroten Lettern auf der Titelseite der größten Boulevardzeitung. Spiegel-Journalisten erfreuen sich an den Inszenierungen türkischer und arabischer Halbstarker, die die einmalige Gelegenheit nutzen, sich vor der ganzen Nation in Szene zu setzten: Da werden Messer gezeigt, Steine geworfen und wilde Geschichten von Überfällen, Knast und Lehrerdresche – wohlgemerkt: in Umkehrung der klassischer Rollenbesetzung – zum Besten gegeben. Die Medienmeute sinniert über Jugendgewalt, Bildungskatastrophe und »Parallelgesellschaften«. Bestürzte und auf einmal unglaublich engagierte Politiker sehen sich mit teils resignierten, teils wütenden Statements von Lehrern und Sozialarbeitern konfrontiert.
So wurde die Schule über Nacht zum Sinnbild für eine der Verrohung anheimfallende Generation junger Migranten, für Gewalt, Hoffnungslosigkeit und Ausgrenzung.
Brandbriefe schreiben!
Was seither geschah, erscheint der interessierten Öffentlichkeit wie ein bildungspolitisches Wunder: Seit das Konzept des neuen »Campus Rütli« im Januar diesen Jahres auf einer Pressekonferenz präsentiert wurde, reiben sich die gleichen Unken, die noch vor zwei Jahren den Untergang des Abendlandes beschworen hatten, die Augen. »Rütli« steht auf einmal für alles, was Perspektive und Aufbruch in der Bildung verspricht.
Die einst berüchtigte »Gewaltschule« wird zum Kern eines Modellprojekts. Schulen, Kitas, Jugendzentren und Berufsförderung werden eng vernetzt. Aus der Haupt- wird eine Gemeinschaftsschule, Klassen werden verkleinert, innovative Konzepte verwirklicht. Überfällige Baumaßnahmen werden in Angriff genommen und neue Flächen erschlossen. Man ist geneigt, den Kollegien an Schulen mit ähnlichen Problemen zuzurufen: Schreibt einen Brandbrief, der Rest kommt dann von selbst!
Bürgerschaftliches Engagement
Ist der Hype um das »Wunder von Neukölln« vielleicht doch nur großes Theater?
Wohl kaum. Aber der Wandel fällt nicht vom Himmel, er hat Vorläufer und lokale Ursachen, die in der allgemeinen Empörung vor zwei Jahren übersehen wurden. Diese Sprossen gedeihen heute prächtig – auch angesichts der neuen finanziellen Bewässerungsquellen, die durch den Medienrummel fleißiger sprudeln.
Einer der Sprossen ist die »AG Bildung«, ein Bürgerschaftliches Gremium, das als Beirat beim Quartiersmanagement arbeitet. Dort treffen sich engagierte Eltern und Bürger schon seit langem mit Vertretern der Schulen und Bildungseinrichtungen im Kiez. Aus dem Umfeld des Quartiersmanagements ging auch der 2007 gegründete »Bildungsverbund« hervor. Hier werden nicht nur Fördergelder koordiniert. Es werden auch so genannte interkulturelle Moderatoren mit Migrationshintergrund gefördert – inzwischen sogar vom Senat. Sie vermitteln zwischen Schulen und den Eltern, die oft kaum Deutsch sprechen.
Die »AG Bildung«, die in den Jahren 2001 und 2002 wichtige Impulse für die Veränderungsprozesse setzte, denkt beispielsweise darüber nach, wie deutschsprachige Eltern dazu gebracht werden können, ihre Kinder im Bezirk einzuschulen, statt die Flucht in weniger Problem beladene Stadtteile anzutreten. Aufgrund des Wegzugs vor allem mittelständischer Familien sind Kinder unter 6 Jahren um cirka 30 Prozent stärker vertreten als diejenigen im schulpflichtigen Alter. Die Jugendlichen im Kiez stammen zu 70 bis 80 Prozent aus Einwandererhaushalten, und die Befürchtung, dass diese Situation der Sprachförderung nicht dienlich ist, dürfte nicht aus der Luft gegriffen sein.
Den vollständigen Beitrag können Sie in unserer Ausgabe Betrifft KINDER 10/08 lesen.