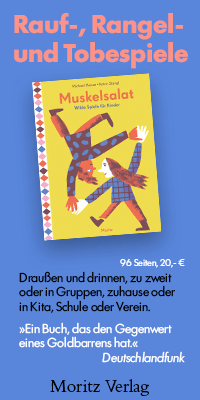|
Fünf Jahre nach dem Pisa-Schock:
Was man vom DDR-Schulsystem noch immer lernen kann
Vor genau fünf Jahren entdeckte die deutsche Nation plötzlich, dass das eigene Bildungssystem doch nicht das beste der Welt ist, und eine Reformwut brach aus, die bis heute anhält. Bildungspolitiker pilgerten ins gelobte Land des Pisa-Siegers Finnland, staunten, dass es Schulen gibt, in denen man den Versuch macht, jedes Kind zu fördern.
Aber einige sagten, dass man gar nicht so weit zu reisen bräuchte, wenn man nur einmal auf das Bildungssystem der DDR zurückblickte. Mancher Politiker schloss sich dem an. »Die haben im Osten zwar ein ideologisiertes Schulsystem gehabt, aber im Prinzip ein richtiges«, sagte die FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher 1992 in der »Berliner Zeitung«. Und der deutsche Pisa-Chef Jürgen Baumert sagte zur Auswertung der TIMS-Studie 1998, dass »Schüler im Einheitsschulsystem der ehemaligen DDR tendenziell oder deutlich bessere Leistungsergebnisse« erreicht hätten als Schüler aus dem Westen. Was ist dran? Was war an diesem System wirklich vorbildlich? Gewiss nicht das, was heute den meisten einfällt: Fahnenappell, Staatsbürger- und Wehrkunde, Disziplinierung, ideologische Beeinflussung über Bildungsinhalte, FDJ und Pioniergruppe – auch wenn das schlagwortartig klingt, denn der sonstige Alltag sah aus wie der an vielen Schulen dieser Welt: mit Geschrei auf dem Schulhof, beliebten und »doofen« Fächern, guten und weniger guten Lehrern. Was aber war’s stattdessen?
Ein neues Dach reicht nicht
Markuu Suortamo von der finnischen Schulbehörde bestätigte 2004, dass sich Finnland an der DDR orientiert habe, als es 1973 die neunjährige »Schule für alle« einführte. Auch in Deutschland ist nach Pisa die Idee der Gemeinschaftsschule wieder aufgelebt. Die rot-rote Koalition will sie in Berlin modellhaft einführen. Die CDU entgegnet, das sei ideologisches Geklingel. Die Probleme an den regulären Schulen blieben bestehen: Unterrichtsausfall, Überlastung, Lehrermangel. Das stimmt durchaus. Es reicht nicht, alle Schüler unter einem neuen Dach zusammenzutun. Das Ergebnis wäre vielleicht, dass Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen oder Lernschwache das Fortkommen der ganzen Klasse behindern oder Cliquen die Schule terrorisieren, dass Eltern auf die Barrikaden steigen, weil sie ihre Kinder nicht mehr nach der vierten Klasse aufs Gymnasium schicken könnten. Es müsste eine ganz andere Schule sein.
In der DDR überließ man es nicht dem Ringen einzelner Lehrer, Klassen mit Schülern unterschiedlicher Herkunft ins Ziel zu führen, sondern man organisierte das Zusammenwirken. Es gab Fachzirkel, oft schulübergreifend. Regelmäßig tagte der »Pädagogische Rat« zu bestimmten Themen. Jeder Lehrer musste innerhalb von fünf Jahren drei Weiterbildungskurse besuchen – in den Ferien. Regelmäßig traf sich das Kollegium, um etwa zu verhindern, dass Schüler sitzen bleiben. Traf das 1950 noch 12 Prozent der Schüler, so waren es seit Mitte der 70er Jahre nur noch zwischen 1,2 und 1,5 Prozent pro Jahr.
Insgesamt hat sich die DDR dem Problem gestellt, das die Deutschen seit Pisa als ihr wichtigstes in der Bildung sehen: die Förderung Begabter, aber auch Benachteiligter und Lernschwacher. Obwohl – zugegeben – die riesigen Herausforderungen, vor denen heutige Schulen in Migrantenbezirken stehen, damals völlig unbekannt waren.
Nach Begabten suchte man gezielt. Unvergesslich bleibt dem 1968 Eingeschulten zum Beispiel, wie eines Tages Talentsucher durch die Klasse gingen. Der Banknachbar hatte einen kräftigen Körper und volle Lippen. Man sagte, das sei ideal, um Trompeter zu werden. Er wurde später Posaunist in einem bekannten Quintett und ist heute Direktor der Philharmonie Chemnitz. Und so entdeckte man auch Sportler oder Sprachtalente. Das war eine gesellschaftliche Aufgabe, sie wurde nicht dem Zufall oder privater Initiative überlassen.
Und die Benachteiligten? Schon im Kindergarten stellten Erzieherinnen, aber auch Psychologen oder Schulärzte fest, ob ein Kind Sprachprobleme oder andere Schwierigkeiten hatte. Es gab Hilfs-, Sprachheil- oder Gehörlosenschulen. Hier wurde nicht viel Zeit verschenkt. Heute, so erzählt die Direktorin einer Marzahner Lernbehindertenschule, müssten sich Kinder »zwei Jahre an der normalen Schule quälen«, bevor sie spezielle Hilfe erhielten – auch wenn Eltern dies wollten.
Apropos Eltern: Ein Hausbesuch des Klassenlehrers nach Anmeldung war in der DDR eine ganz normale Sache. Gewiss erfüllte das auch eine Kontrollfunktion (gucken die Eltern West-Fernsehen, welche Meinungen haben sie?), aber viele Kinder profitierten davon, dass Lehrer und Eltern zusammenarbeiteten. Heute gibt es Lehrersprechstunden, für die sich Eltern rechtzeitig anmelden müssen. Gute Lehrer finden dennoch die Zeit, außer der Reihe intensiv mit Eltern zu arbeiten. Schön, wenn man diese Erfahrung gerade an der Schule der eigenen Töchter machen durfte.
Dem DDR-System wird vorgeworfen, eine politisch-ideologische Sortiermaschine gewesen zu sein. Begabung half oft auf der Bildungsleiter nicht weiter, wenn man kirchlich gebunden war oder keinen »Klassenstandpunkt« erkennen ließ. Beim Übergang zum Abitur förderte man jene, die Lehrer oder Offizier werden wollten. Hier wurden Heuchelei und Doppelzüngigkeit gefördert. Daneben aber – und das wiederum ist bedenkenswert – strebte die DDR eine breite, solide Bildung aller an. Und sah sich dafür verantwortlich. Die Zahl der Un- oder Angelernten sank von fast 67 Prozent (1955) auf 15 Prozent (1985). Zu dieser Zeit bildeten die fast tausend Berufsschulen 400.000 Lehrlinge aus. Die Ausbildungsbetriebe mussten jedem von ihnen ein halbes Jahr vor seinem Abschluss einen Arbeitsvertrag anbieten.1
Die polytechnische Bildung war das Markenzeichen der DDR-Schule. Fächer wie Schulgarten, Werken, Technisches Zeichnen, Einführung in die sozialistische Produktion (ESP) sollten die Bodenhaftung sichern. Auch künftige Abiturienten lernten den Arbeitsalltag in Betrieben kennen, feilten, löteten, wickelten Basteldraht am Unterrichtstag in der Produktion (UTP).
Einheit von Rostock bis Suhl
Man fordert heute – nach Pisa eine möglichst späte Sortierung der Schüler und eine größere »Durchlässigkeit« des Bildungssystems. Beides hat die DDR auf ihre Art gesichert, weil man auch noch schulischen »Spätzündern« und Berufstätigen Wege offen halten wollte. Wer nicht nach der 8. Klasse zum Abitur überging, der konnte nach der 10. Klasse eine Berufsausbildung mit Abitur machen. Nach der Lehre war es möglich, eine Fachschule zu besuchen. Zu den 19 Prozent Abiturienten kamen jene hinzu, die über Fach-, Ingenieur- und Volkshochschulen Abitur machten. Die Wege waren dann meist fachspezifisch.
Seit Jahren versucht Deutschland, das große Niveaugefälle zwischen den Bundesländern zu nivellieren – über Bildungsstandards und bundesweite Tests. Aber Hunderte unterschiedlicher Lehrpläne hindern bis heute Schüler, die von Berlin nach Bayern umziehen, daran, Anschluss zu finden. In der DDR gab es überall gleiche Lehrpläne? – ob in Rostock oder Suhl.
Niemals! rufen die Bundesländer. Das bedeute Gleichmacherei und Inhaltsverarmung. Allerdings forderte jüngst der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, einen allgemeinen Bildungskanon für Literatur. Schüler sollten das Nibelungenlied, Lessings Ringparabel, Schiller-Balladen, Gottfried-Keller-Novellen und Brecht-Geschichten kennen. All das stand in den Lehrplänen der DDR-Schule.
Am Ende ist es wie in allen monolithisch wirkenden Systemen. Vieles hing von jenen ab, die die »von oben« kommenden Vorgaben umsetzen mussten: den Lehrern.
Als der Schüler in der Prüfung 10. Klasse gefragt wurde, was Kunst sei, antwortete er mit dem erlernten Spruch des Autors Friedrich Wolf: »Kunst ist Waffe im Klassenkampf«. Der Lehrer fragte: »Aber was soll Kunst vor allem sein?« Der Schüler zuckte mit den Schultern. Nicht Waffe? Nicht Kampf? Was dann?
»Na schön soll sie sein! Kunst soll den Menschen vor allem erbauen und berühren!« antwortete der Lehrer. Der Schüler vergaß das nie.
Torsten Harmsen,
»Berliner Zeitung«
1 Die Zahlen entstammen der Broschüre »Das Bildungswesen der DDR« von Günter Wilms.
Siehe auch: www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=679882
Den vollständigen Beitrag können Sie in unserer Ausgabe Betrifft KINDER 12/06 lesen.